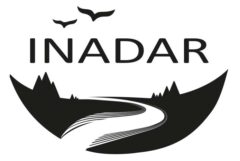Welche Umweltprobleme entstehen bei der Dammsanierung und -erhöhung?
Heutzutage sind die Flussufer der meisten Wasserkörper mit Dämmen mit Wellenbrechern aus Beton bedeckt. Die an den Ufern verbauten Betonplatten stellen üblicherweise kein besonders geeignetes Habitat für Tier- und Pflanzenarten dar, wodurch eine klassische Ufervegetation verhindert wird. Auch der Kontakt zu den umliegenden Flächen ist sowohl hydrologisch als auch ökologisch weitestgehend unterbrochen. Hinzu kommt, dass gerade Hybridgewässer, wie sie an staugeregelten Flüssen entstehen, meist weder Fließ- noch Stillgewässer sind und daher lediglich wenig spezialisierten Arten einen geeigneten Lebensraum bieten.

Neue Bauweise mit Öko-Bermen
Aufgrund dieser Problemstellung hat die LEW Wasserkraft gemeinsam mit der Obere Donau Kraftwerke AG (ODK) und weiteren Projektpartnern einen neuen Ansatz für umweltfreundlichere Dammerhöhungen und Dammsanierungen entwickelt, welcher im Rahmen des von der EU geförderten LIFE-Projekts INADAR umgesetzt und getestet wurde. Kern des neuen Ansatzes ist der Einbau von sogenannten „Öko-Bermen” an wasserseitige Böschungen in Stauräumen (mehr dazu hier).

Ausgehend von den genannten Problemstellungen verfolgte das Projekt mehrere Ziele:
- effiziente Sanierung und Erhöhung von Dämmen
- deutliche Verbesserung des ökologischen Potenzials von Flussufern und der Umgebung für Flora und Fauna – und damit für den gesamten Wasserkörper
- Vermeidung von Eingriffen in bestehende wertvolle Auenwälder und Reduzierung des Bedarfs an Kompensationsmaßnahmen
- Reduzierung des Flächenverbrauchs von Dämmen
- Entwicklung von vereinfachten Genehmigungsprozesse für die Umsetzung von Öko-Bermen.
Herausforderungen beim Bau von Öko-Bermen
Eine Sanierung mit Öko-Bremen auf der Wasserseite führt auf technischer Ebene zu Herausforderungen, da der Aufbau neuer Dammschüttungen auf breiig-weichen Fluss-Sedimenten sowohl zu standsicherheits- als auch setzungsbedingten Problemen führen kann. Dies tritt insbesondere auf, wenn gleichzeitig auf der wasserseitigen Böschungsoberfläche ein zweites Dichtungselement eingebaut werden muss.
Standsicherheitsprobleme (Geländebruch unter den wasserseitigen Schüttungen) werden meist auch von vergleichsweisen großen Setzungen begleitet, die zu starken Scherverformungen an den auf der wasserseitigen Böschung liegenden Betonplatten führen (s. Abb.). Ein weiteres Ziel war daher, die besonderen bautechnischen Bedingungen, die Standsicherheit als auch das Verformungsverhalten beim Aufbau der Versuchsstrecken zu untersuchen.
Ein Fachgespräch mit Herrn Stiegler von der TUM zu den technischen Herausforderungen können Sie hier bei YouTube ansehen.
Weiterlesen: Unser Lösungsansatz –Wie Öko-Bermen den Fluss mit der Aue verbinden